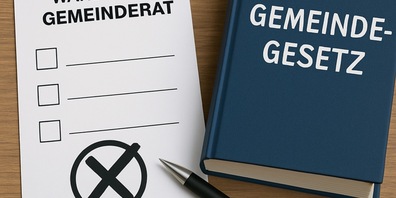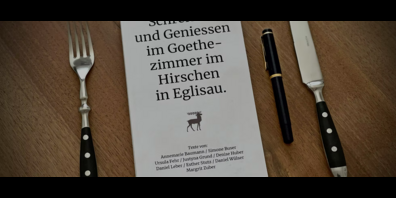Kommentar von Peter Wick, Verleger ZU24.ch:
Fussball geht auch friedlich
Frauenfussball macht’s vor – doch im Männerfussball sorgt Gewalt weiter für Schlagzeilen. Was jetzt zu tun ist.
Kaum hat die neue Saison begonnen, sorgt der Schweizer Männerfussball erneut für Negativschlagzeilen: Ausschreitungen, Sachbeschädigungen, Gummischrot, etc. – das alte Muster setzt sich schon beim ersten Spiel der Saiosn in Zürich fort. Viele Fans und Verantwortliche fragen sich: Muss das sein?
Dabei zeigt der Fussball eindrücklich, dass es auch anders geht. Während der UEFA Women’s Euro in der Schweiz herrschte überall eine friedliche, ausgelassene Stimmung – ohne Pyros, ohne Gewalt, ohne Polizeiaufgebote. Es wurde gesungen, gefeiert und mitgefiebert – genau so, wie Fussball sein sollte: verbindend statt spaltend.
Was läuft falsch?
Im Gegensatz zum Frauenfussball hat sich im Männerbereich eine gewaltbereite Minderheit etabliert, die gezielt Randale sucht. Sie missbraucht die Plattform Stadion und Fussballspiele, um Konfrontation mit Sicherheitskräften oder rivalisierenden Gruppen zu provozieren. Das gefährdet nicht nur die Sicherheit der friedlichen Sportfans und auch Jungen Zuschauer, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz des Sports.
Diese Massnahmen könnten helfen
Um das Gewaltproblem zu lösen, braucht es ein entschlossenes Zusammenspiel von Klubs, Liga, Behörden und Fans:
-
Konsequente Stadionverbote: Wer Gewalt anwendet, verliert das Recht auf Stadionbesuche. Nationale Datenbanken müssen konsequent genutzt werden.
-
Kosten der Polizeieinsätze müssen mindenstens teilweise die Clubs (und die gewaltbereiten Fans) bezahlen.
-
Ausweiskontrolle: Alle Stadion-Besucher müssen sich ausweisen können, damit wir die Möglichkeit geboten Chaoten besser zu identifizieren - dies ist in England seit Jahren gang und gäbe und hat die Situation hinsichtlich Holligans auf der fussballverrückten Insel massiv verbessert.
-
Verbesserte Fanarbeit: Clubs sollten ihre Fanarbeit intensivieren, Vertrauen aufbauen und präventiv mit Fangruppen zusammenarbeiten.
-
Dialog statt Konfrontation: Gewaltprävention durch Dialogmodelle wie das in Deutschland erprobte „Kooperative Sicherheitsmodell“ zeigt Erfolg.
-
Alkoholkonsum eindämmen: Ein gezieltes Alkoholverbot in Hochrisikospielen kann deeskalierend wirken.
-
Verantwortung der Clubs stärken: Clubs sollten für das Verhalten ihrer Fans stärker zur Verantwortung gezogen werden – finanziell oder mit Punktabzügen.
-
Klare Kommunikationslinien: Schnelle, transparente Kommunikation bei Vorfällen hilft, Gerüchte und Mythen gar nicht erst entstehen zu lassen.
-
Rollenbilder hinterfragen: Fussball darf nicht zur Bühne für toxische Männlichkeit werden – Vorbilder im Profibereich können hier neue Zeichen setzen.
Die Wahl liegt bei uns allen
Fussball kann verbinden, begeistern und friedlich gefeiert werden – wenn der Wille da ist. Doch dieser ist sowohl auf Fan- als auch auf Clubebene vielfach nur ungenügend vorhanden.
Die Vereine und ihre Präsidenten müssen den Mut aufbringen, sich klar und unmissverständlich von gewaltbereiten Fangruppen zu distanzieren – auch wenn dies gegenüber der Hardcore-Fanszene unpopulär ist und mancher die Zuschauerzahlen schwinden sieht.
Ein wirksames Signal wäre, die durch Polizeieinsätze entstehenden Kosten mindestens teilweise direkt den Clubs zu verrechnen. Ich bin überzeugt: Die Situation würde sich in kürzester Zeit spürbar verändern.
Der Frauenfussball zeigt, wie's geht. Wer nur Randale sucht, hat an den Fussballspielen nichts verloren. Jetzt braucht es den Mut, neue konsequente und meines Erachents auch drastische Wege zu gehen. Damit der Sport wieder das wird, was er sein soll: ein Sportfest für alle.